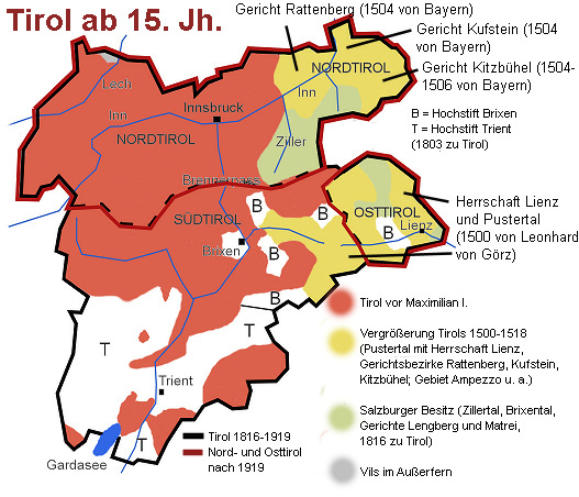Vor- und Frühgeschichte
Römer
Völkerwanderung - Baiuwaren
Herrschaft der Bischöfe - Aufstieg großer Adelsfamilien
Entstehung der Grafschaft Tirol - Graf Albert III. und Graf Meinhard II.
Margarete Maultasch - Tirol kommt an die Habsburger
Erste Tiroler Linie der Habsburger
Kaiser Maximilian I. und Tirol
Reformation - Bauernkriege - Täufertum
Vor- und Frühgeschichte
Ca. 25.000 v. Chr.
Älteste menschliche Siedlungen in der Tischofer
Höhle bei Kufstein - Funde von Tierskeletten
Ca. 10.000 v. Chr.
Zunahme der Jagd- und Siedlungsplätze im ganzen
Land nach dem Ende der letzten Eiszeit
Ca. 5.000 v. Chr.
Jungsteinzeit: Keramik, Beisetzung der Toten in
Steinkistengräbern
Ca. 3.500 v. Chr.
Mittlere Kupferzeit: Abbau und Verhüttung von
Kupfererzen
Ca. 3.200 v. Chr.
1991 Fund der Gletschermumie “Ötzi” am
Hauslabjoch in den Ötztaler Alpen
Ca. 2.000-750 v. Chr.
Bronzezeit: Abbau und Verhüttung von Kupfer
Ca. 1.300-750 v. Chr.
Urnenfelderzeit in Nordtirol mit Zentrum in
Hötting (Innsbruck), gleichzeitig Laugen-Melaun-
Kultur in Südtirol und im Trentino
Ca. 750-500 v. Chr.
Ältere Eisenzeit (Hallstattzeit): Einfluss des
Salzbergbaus in Hallstatt
Ca. 500-100 v. Chr.
Jüngere Eisenzeit (La Tène-Zeit): Erstmals
Ausbildung einer gemeinsamen Kultur im Tiroler
Raum, benannt nach den Hauptfundorten
Fritzens (Inntal) und San Zeno (Nonsberg/
Trentino), als Träger das Volk der Räter
(Urbevölkerung Tirols), zahlreiche Funde im
Wattener Himmelreich
[zurück]
Römer
15 v. Chr.
Drusus und Tiberius erobern das zentrale
Alpengebiet und das Alpenvorland
Um 50 n. Chr.
Einrichtung von Provinzen: Rätien (bayerisch-
schwäbisches Alpenvorland, Graubünden,
westliches Inntal bis zum Ziller, Vinschgau,
Eisacktal) mit dem Hautport Augsburg; Noricum
(Pustertal, Osttirol sowie Nordtirol östlich des
Zillers)
51-54 n. Chr.
Ausbau des Straßennetzes unter Kaiser Claudius:
Via Claudia Augusta als Nord-Süd-Verbindung
durch Tirol
Um 400 n. Chr.
Ausbreitung des Christentums in Tirol
476
n. Chr.
Ende des Weströmischen Reiches, Rückzug der
Römer
Unter den Römern erlebt unser Land eine lange Friedenszeit. Die
Bevölkerung wird auf friedliche Weise romanisiert. Kultur und Wirtschaft
erleben einen Aufschwung. Nur zwei Städte entstehen - Trient und
Aguntum (bei Lienz). In Wilten bei Innsbruck entsteht das Römerlager
Veldidena. Die Bevölkerung übernimmt viel von den Römern, so etwa
Wörter, Bautechnik, Anbaumethoden, Obstbau etc.
[zurück]
Völkerwanderung - Bajuwaren
Um 500
Gebiete an der oberen Etsch, am Eisack und am
Inn gehören zum Herrschaftsbereich des
Ostgotenkönigs Theoderich des Großen
Nach 550
Vorstoß verschiedener Völker von allen Seiten in
die Alpentäler: von Süden Langobarden (Trient
wird Sitz eines Herzogs), von Westen über den
Vinschgau Franken, von Norden Alemannen in das
oberste Lechtal sowie Bajuwaren in das Inntal und
über den Brenner in das Eisack- und Pustertal, wo
sie um 600 bei Lienz auf die von Osten in das
heutige Osttirol vergedrungenen Slawen stoßen
7. Jh.
Im Raum des späteren Tirol übernehmen die
Bajuwaren aus dem Geschlecht der Agilolfinger
und die Langobarden die Herrschaft
[zurück]
Die Herrschaft der Bischöfe - Aufstieg großer Adelsfamilien
10. Jh.
Die Bischöfe von Säben-Brixen erhalten reiche
Schenkungen von den deutschen Königen bzw.
Kaisern; Verlegung des Bischofssitzes von Säben
nach Brixen
1004/1027/1091
Belehnung der Bischöfe von Brixen und Trient mit
den Grafschaften “im Gebirge” vom Inntal bis zur
Veroneser Klause
12./13. Jh.
Gründung von Klöstern, Übergabe des “Landes
im Gebirge” an weltliche Fürsten als Lehen,
Zunahme des Handels über den Brenner- und
Reschenpass
Kaiser Heinrich II. und seine Nachfolger belehnen die Bischöfe von
Brixen und Trient mit den Gebieten um Trient, im Vinschgau, im Inn-,
Eisack- und Pustertal zu Sicherung der Handelswege und des Durchzugs
der deutschen Könige zur Kaiserkrönung nach Rom. Damit übernehmen
die Bischöfe auch weltliche Herrschaft im “Land im Gebirge”, das eine
wichtige Verbindung zwischen dem Süden und der Mitte bzw. dem
Norden Europas darstellt. Die Bischöfe werden zu Fürstbischöfen und
bleiben es bis 1803.
Es folgt eine langsame Loslösung der Alpentäler im Gebiet des späteren
Tirol vom Herzogtum Bayern im Norden und von der Mark Verona im
Süden.
Adelige, Klöster und Bischöfe bauen aus dem süddeutschen Raum ihre
grundherrlichen Rechte auf beiden Seiten des Brenners aus, wobei vor
allem Weingüter sehr begehrt sind.
Die Bischöfe von Brixen und Trient, die Bischöfe von Freising
(Grundbesitz im Gebiet von Innichen) und Regensburg (Besitzungen im
Unterinntal bei Kufstein) erhalten vom Kaiser bzw. König Rechte und
Einnahmen übertragen (etwa Bergwerks- und Zollrechte). Sie gründen
neue Klöster (St. Georgenberg nahe Schwaz, Wilten, Neustift bei Brixen,
Marienberg u. a.).
Es erfolgt eine Zunahme des überregionalen Handels über Brenner- und
Reschenpass, was zur Entstehung von Gasthöfen bzw. Unterkünften und
Herbergen sowie der entsprechenden Infrastruktur (Schmiede, Sattler,
Fuhrgewerbe etc.) führt. Zur Sicherung der Straßen entstehen entlang der
Hauptverkehrswege Burgen und Städte, so etwa Bozen und Innsbruck.
Die Bischöfe von Brixen und Trient suchen sich Grafen als Schutzherrn
(Vögte) und übertragen ihnen die vom Kaiser bzw. König verliehenen
Länder als Lehen. Im Laufe der Zeit drängen diese Grafen den Einfluss der
Bischöfe zurück und machen ihre Ländereien erblich.
•
Grafen von Andechs aus Südbayern: seit ca. 1180 Herzöge, Besitz im
mittleren Inntal zwischen der Melach im Westen (Mündung des
Sellraintals, Martinswand) und dem Ziller im Osten (Zillertal) sowie
Teile des Wippals und das Pustertal, Stammsitz Burg Ambras, 1180
Gründung von Innsbruck
•
Grafen von Eppan: Besitz im Bozener Raum, in Überetsch und Ulten,
Stammsitz Burg Hocheppan
•
Grafen von Tirol: Ländereien im Burggrafenamt, im Vinschgau und
im Etschtal, Vögte der Bischöfe von Trient, Stammburg Schloss Tirol
bei Dorf Tirol nahe Meran
•
Grafen von Görz: Besitz am Isonzo, in Kärnten, im heutigen Osttirol
und im Pustertal, Stammburg Schloss Bruck bei Lienz
Graf Albert III. von Tirol erringt zusätzlich zur Vogtei (Schutzherrschaft)
über Trient auch die Vogtei über Brixen. Er besiegt die Grafen von Eppan
als Konkurrenten im Bozener Raum und gewinnt die Herrschaftsrechte
nördlich des Reschenpasses. Weiters fallen nach dem Aussterben der
Grafen von Andechs (1248) auch deren Gebiete nördlich des Brenners
und im Inntal an ihn - somit erlangen die Grafen von Tirol auch die
Gebiete der Grafen von Eppan und Andechs und sind die Herren über
das Etsch-, Eisack- und Inntal.
[zurück]
Die Grafschaft Tirol entsteht - Graf Albert III. und Graf Meinhard II.
1253
Der Tod Graf Alberts III. bedeutet das Ende der
Tiroler Grafen im Mannesstamm. Sein Erbe
südlich und nördlich des Alpenhauptkamms fällt
an seine
Schwiegersöhne Graf Gebhard von
Hirschberg und Graf Meinhard III. von Görz (als
Graf von Tirol-Görz Meinhard I.)
1258-1295
Graf Meinhard II. wird zum “Schmied des Landes
Tirol” und teilt seine Rechte 1271 mit seinem
Bruder Albert, der die Herrschaft Görz (Gebiet
im Pustertal östlich der Mühlbacher Klause)
übernimmt. Unter Graf Meinhard II. erhält das
“Land im Gebirge” seinen Namen Tirol.
Graf Meinhard II. kann durch Kauf, Verträge, Erbschaften und mit Gewalt
jene Grafschaft Tirol schaffen, die mit einigen späteren Erweiterungen bis
1918 besteht. Als Freund und Mitstreiter König Rudolfs I. von Habsburg
erhält er 1286 das Herzogtum Kärnten als Lehen übertragen.
Nach seinem Tod regieren seine Söhne Otto, Ludwig und Heinrich. Graf
Meinhard II. liegt in dem von ihm gestifteten Zisterzienserkloster Stams
im Oberinntal begraben, wo sich die Grablege der Tiroler Landesfürsten
befindet.
[zurück]
Margarete Maultasch - Tirol kommt an die Habsburger
1310-1363
Margarete Maultasch ist der letzte Spross der
Grafen von Tirol. Verschiedene Herrscherfamilien
zeigen großes Interesse für das reiche Land.
Margarete heiratet in erste Ehe Johann Heinrich
von Luxemburg-Böhmen, den sie allerdings
verstößt. Eine zweite Ehe geht sie mit dem
Wittelsbacher Markgrafen Ludwig von
Brandenburg ein. Als Erdbeben, Missernten und
die Pest Tirol heimsuchen, gibt die Bevölkerung
ihrer Landesherrin dafür die Schuld.
1363
Nach dem Tod ihres Sohnes Graf Meinhard III.
übergibt Margarete Maultasch Tirol an den
Habsburger Herzog Rudolf IV. Vergeblich
versuchen die Bayen das Land zu erobern. An
diese Übergabe erinnert der Rudolfsbrunnen am
Bozner Platz in Innsbruck.
[zurück]
Erste Tiroler Linie der Habsburger (1439-1490)
1363-1365
Herzog Rudolf IV. von Österreich ist auch Graf von
Tirol.
1365
Nach Rudolfs Tod übernehmen seine beiden
Brüder Herzog Albrecht III. und Herzog Leopold III.
zunächst gemeinsam die habsburgischen Länder,
darunter auch Tirol.
1379
Im Teilungsvertrag von Neuberg an der Mürz
zwischen den Brüdern Herzog Albrecht III. und
Herzog Leopold III. fallen Tirol, die Steiermark,
Kärnten, Krain, die Windische Mark und die
Vorlande im Westen an Leopold III. Herzog
Albrecht III. erhält Österreich ob und unter der
Enns (Oberösterreich und Niederösterreich).
1386
Herzog Leopold III. fällt in der Schlacht bei
Sempach gegen die Schweizer. Damit verlieren die
Habsburger ihre Stammlande im Westen.
1404
Herzog Leopold IV. bestätigt die alten Rechte der
Tiroler
1406-1439
Erste Tiroler Linie der Habsburger mit Herzog
Friedrich IV. mit der leeren Tasche
•
Bestätigung der alten Rechte der Bauern und Einschränkung
der Macht des Tiroler Adels - Adelsaufstände werden blutig
niedergeschlagen
•
Verlust seiner Länder im Konzil von Konstanz, da er den
Gegenpapst Johannes XXIII. unterstützt, bekommt seiner Länder
aber wieder zurück und wird rehabilitiert
•
1420 Verlegung des Regierungssitzes von Meran nach
Innsbruck, dadurch Gründung der habsburgischen Residenz in
Innsbruck - Regierungssitz ist der Neuhof (Goldenes-Dachl-
Gebäude) - Landeshauptstadt nach Meran wird Innsbruck erst
1849
•
Beginn des Bergbaus (Silber und Kupfer) mit Zentrum Schwaz
1439-1490
Erste Tiroler Linie der Habsburger mit Erzherzog
Sigmund dem Münzreichen (Sohn von Friedrich)
•
Beginn des Baus der Hofburg in Innsbruck
•
Konflikt mit Kardinal Nikolaus Cusanus wegen Tirol
•
Verlegung der Münzprägestätte von Meran nach Hall und
große Münzreform 1486 (Prägung einer Silbermünze im Wert
einer Goldmünze)
•
Prächtiges Hofleben, Bau von Burgen, über 40 uneheliche
Kinder
•
Zweimal verheiratet, aber keine ehelichen Kinder
•
Wegen seiner Verschwendungssucht Beginn der Verpfändung
der Vorlande an die Bayern
•
1490 Abdankung - Übergabe Tirols an Kaiser Maximilian I.
[zurück]
Kaiser Maximilian I. und Tirol
1490
Erzherzog Sigmund der Münzreiche verzichtet
zugunsten seines Verwandten Maximilian auf
die Regierung in Tirol und den Vorlanden
1496
Tod von Erzherzog Sigmund dem Münzreichen
1500
Maximilian beerbt Graf Leonhard, den letzten
Görzer Grafen, und erhält dadurch das heutige
Osttirol und große Teile des Pustertals östlich der
Mühlbacher Klause - diese Gebiete kommen zu
Tirol.
1504-1506
Im bayerisch-pfälzischen Erbfolgekrieg erlangt
Maximilian die drei Gerichtsbezirke Kufstein,
Kitzbühel und Rattenberg, die Tirol
angegliedert werden.
1511
Im Tiroler Landlibell legt Maximilian fest, dass die
Tiroler nur ihre eigenen Landesgrenzen
verteidigen müssen - das Gesetz gilt bis 1918
1516
Im Frieden von Venedig erhält Maximilian das
Gebiet von Cortina d’Ampezzo, Rovereto, Ala,
Mori, Avio und Brentonico im Etschtal. Dadurch
wird Tirol nochmals vergrößert und reicht bis zum
Gardasee.
1519
Tod von Maximilian in Wels in Oberösterreich.
Auf eigenen Wunsch wird er in der Burgkapelle
von Wiener Neustadt bestattet.
Maximilian macht Innsbruck zum Zentrum seiner Erblande und des
Reiches, indem er hier ein straff organisierte Verwaltung einrichtet, der
sogar die Wiener Behörden unterstellt sind. Innsbruck liegt strategisch
und verkehrsmäßig sehr günstig als Drehscheibe zwischen Nord und Süd
sowie Ost und West. Deshalb lässt er an der Sill auch ein großes
Zeughaus (Waffenlager) errichten.
Er schmückt die Stadt mit dem Goldenen Dachl und beauftragt die
Baumeisterfamilie Türing mit dem Umbau zahlreicher Altstadthäuser.
Maria von Burgund,
Maximilians erste Frau, ist nie
in Österreich. Die fünf Jahre,
die beide verheiratet sind,
verbringt Maximilian in
Burgund. Maria stirbt bei
einem Jagdunfall. Sie haben
zwei Kinder, Philipp und
Margarethe. Durch die Heirat
von Philipp dem Schönen mit
der spanischen Prinzessin Johanna der Wahnsinnigen
gelangt Spanien mit den Überseebesitzungen in
Amerika an die Habsburger.
Seine zweite Frau Bianca Maria Sforza aus
Mailand lebt in der Hofburg, deren Bau
Erzherzog Sigmund der Münzreiche begonnen
hat und Maximilian weiterführt. Die Ehe bleibt
kinderlos.
Der Kaiser hält sich gerne in Tirol auf, wo er
gerne klettert, jagt und fischt. Verschiedene
Burgen, etwa Tratzberg und Fragenstein, bilden
Ausgangspunkte für seine Jagden. Von großer
Bedeutung für ihn sind die reichen
Bodenschätze Tirols, vor allem Silber und Kupfer mit Zentrum Schwaz.
Die Hofkirche mit den 28 überlebensgroßen Bronzefiguren (“Schwarze
Mander”) lässt sein Enkel Kaiser Ferdinand I. erbauen, nicht Maximilian.
Maximilians Nachfolger sind seine Enkel Kaiser Karl V. und Kaiser
Ferdinand I.
[zurück]
Reformation - Bauernkriege - Täufertum
1520
Die Lehren Martin Luthers werden in Tirol
bekannt und verbreiten sich schnell. Die
Habsburger sind katholisch und treten
vehement dagegen auf.
1525/26
Michael Gaismair führt die Bauernaufstände
in Tirol an. Es geht dabei um die
Verwirklichung reformatorischer Ideen, um
die Befreiung von der Unterdrückung durch
die Obrigkeit und um Freiheit für die
Bevölkerung.
Die Habsburger sind katholisch. Gerade auch in Tirol muss die
Bevölkerung katholisch bleiben. Wiedertäufer wir Jakob Hutter aus dem
Pustertal werden des Landes verwiesen oder gefoltert und oft sogar
hingerichtet - Hutter wird vor dem Goldenen Dachl verbrannt. In der
Bevölkerung verbreiten sich die Ideen Luthers rasch, der Tiroler Adel
bleibt jedoch katholisch und damit auch Tirol.
[zurück]





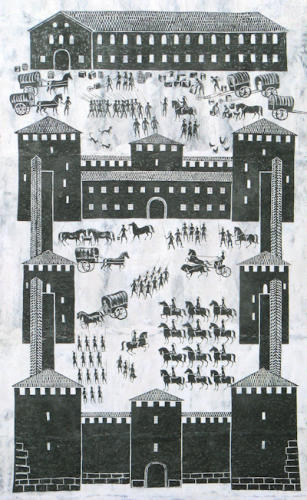























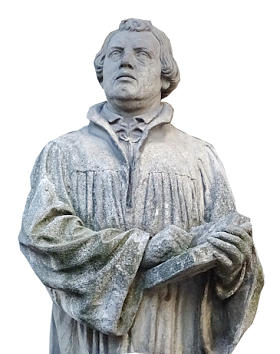
Ergänzungen
Geschichte Tirols bis zum
16. Jh. im Überblick

- Jugend und Erziehung
- Zeit in Burgund
- Maria von Burgund
- Wahl zum deutschen König - 1486
- Erwerb Tirols - 1490
- Wiedererlangung der östlichen Erbländer
- Bretonischer Krieg - Anne de Bretagne
- Nachfolge im Reich - Reichsreformen
- Türkeneinfälle - Politik in Italien
- Bianca Maria Sforza
- Heilige Liga von Venedig - Spanische Doppelhochzeit
- Italienfeldzug 1496
- Weitere Rückschläge
- Ausgleich mit Frankreich - Rom-Spanien-Görz
- Bayerisch-pfälzischer Erbfolgekrieg
- Ungarn - Feldzug und Heiratspläne
- Tod Philipps des Schönen - Probleme mit Frankreich
- Kaiserproklamation in Trient - 1508
- Der Kaiser-Papst-Plan
- Italienkriege - Französisches Bündnis
- Ausgang der Italienkriege
- Der Osten - Ungarisches Doppelverlöbnis
- Letzte Lebensjahre
- Tod und Beisetzung

- Regierungsantritt 1490
- Regierung - Neuordnung
- Postlinie
- Hof in Innsbruck
- Hofleben
- Innsbruck vor Maximilian
- Innsbruck um 1500
- Turniere in Innsbruck
- Kunst in Innsbruck
- Musik am Hof
- Maximilians letzter Besuch
- Maximilians Tod in Wels
- Bianca Maria Sforza
- Plattnereien
- Gusshütten
- Ewiges Gedächtnis
- Hofburg
- Wappenturm
- Zeughaus an der Sill
- Goldenes Dachl
- Hofkirche und leeres Grabmal
- Quaternionenadler
- Altstadthäuser
- Erinnerungen im Überblick

- Figuren im Überblick
- Albrecht I. - Herzog, König
- Albrecht II. - Herzog, Weise, Lahme
- Albrecht II. - König
- Albrecht IV. - Graf von Habsburg
- Artus - König England
- Bianca Maria Sforza
- Chlodwig - König
- Elisabeth von Görz-Tirol
- Elisabeth von Ungarn und Böhmen
- Ernst der Eiserne - Herzog
- Ferdinand von Aragon - König
- Friedrich III. - Kaiser
- Friedrich IV. - Herzog - Tirol
- Gottfried von Bouillon
- Johann von Portugal - König
- Johanna die Wahnsinnige - Spanien
- Karl der Kühne - Herzog, Burgund
- Kunigunde - Erzherzogin
- Leopold III. - Markgraf, Babenberger
- Leopold III. - Herzog - Tirol
- Margarethe von Österreich
- Maria von Burgund
- Philipp der Gute - Herzog, Burgund
- Philipp der Schöne - Herzog
- Rudolf von Habsburg - König
- Sigmund d. Münzreiche - Erzherzog
- Theoderich - König, Ostgoten
- Zimburgis von Masowien
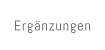
- Figuren Habsburger - Einordnung
- Babenberger und Österreich
- Habsburger und Österreich
- Geschichte Tirols bis 16. Jh.
- Habsburg und Burgund
- Habsburg und Spanien
- Heiliges Römisches Reich
- Kaiser-König-Erzherzog-Herzog
- Erblande-Stammlande-Vorlande
- Kronen
- Wappen
- Orden vom Goldenen Vlies
- Privilegium minus - maius
- Vorlande - Vorderösterreich
- Eheverträge - Heirat - Kinder
- Figuren - Mode der Damen
- Figuren - Rüstungen der Herren
- Figuren - Porträtgenauigkeit
- Maximilian im Porträt (A. Dürer)
- Maximilian - Familienporträt
- Habsburgerstammbaum - Tratzberg
- Maximilian und die Kunst
- Theuerdank - Weißkunig - Freydal

Exercitation est ullamco et
commodo ut. Reprehenderit
enim nisi voluptate, nostrud
irure mollit ullamco nulla
dolore in? Non ad dolore, in
incididunt irure exercitation
ut dolore fugiat ullamco
ipsum et sunt labore duis
nulla pariatur enim. Irure
culpa aliqua, sunt, nisi dolor
consectetur veniam
cupidatat non nostrud
laboris culpa. Nisi esse, sint,
enim esse est sed cupidatat
sit elit.
Ex dolore enim: Incididunt in consequat duis do ut
officia sunt ut elit. Adipisicing cupidatat id ipsum
quis ea ut ullamco ad officia aute aliquip occaecat
non duis.
Exercitation consectetur sunt pariatur
Sit deserunt proident ad in fugiat adipisicing esse labore aute, exercitation id sint ut. Sit cillum est, voluptate magna, cillum dolore anim et in in sunt, voluptate dolor labore. Deserunt, amet ipsum excepteur minim. Sed eiusmod irure amet in occaecat esse cillum ad excepteur ut et, sunt irure ut, dolor eiusmod nostrud officia. Excepteur, fugiat laboris, proident enim in. Mollit ullamco amet anim labore voluptate qui deserunt sint ad ut: Sit enim ad commodo eu magna esse voluptate veniam consectetur ullamco lorem, in sunt reprehenderit velit ipsum. Aliquip qui lorem qui sit.Elit dolor dolore nulla. Excepteur dolore consequat non sed et magna sint aliqua consequat, qui sed nostrud, duis eu. Quis duis tempor esse ut pariatur ipsum.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor
eu eiusmod lorem 2013

SIMPLICITY


Dolor sunt occaecat commodo officia deserunt
irure. Dolore eu in enim aliqua qui labore
consequat laboris qui officia ipsum. In ea minim
culpa duis consequat cupidatat do.
Cupidatat lorem quis tempor reprehenderit quis
aliqua pariatur aliquip eiusmod ut minim dolore in
nostrud mollit enim velit in. Ullamco non
exercitation. Velit ullamco sint occaecat veniam
dolore aliqua ipsum in reprehenderit sed do aliqua
nulla enim ut.
Sed dolore tempor eiusmod esse laboris dolore,
esse deserunt aliquip sit aute, labore sunt anim. Ad
anim ipsum eiusmod in elit incididunt non sint
tempor sunt ad incididunt aliquip do! Ut amet
pariatur sint, elit labore pariatur ut aute.


- HOME
- max-jugend-erziehunjg
- max-burgund
- vorlage-01
- max-maria-burgund
- max-wahl-dt-koenig
- max-erwerb-tirol
- max-wiedere-oestl-erblaender
- max-bretonischer-krieg-ann-bretagne
- max-nachfolge-reich
- max-tuerken-italien
- max-hochzeit-bianca-maria-sforza
- max-liga-venedig-span-doppelhochzeit
- max-italienfeld-1496
- max-weitere-rueckschlaege
- max-ausgleich-frankreich-rom-spanien-goerz
- max-bayerische-erbfolgekrieg
- max-ungarn-heiratsplaene
- max-tod-philipps
- max-trient
- max-kaiser-papst
- max-italienkriege-franz-buendnis
- max-ausgang-italienkriege
- max-osten-doppelverloebnis
- max-letzte-jahre
- max-tod-beisetzung
- max-tirol-bedeutung
- max-jagd
- max-jagd-arten
- max-jagd-waffen-hunde
- max-tirol-vergroesserung
- max-tirol-landlibell
- max-tirol-bodenschaetze
- max-tirol-grafschaft
- max-tirol-orte
- max-ibk-regierungsantritt
- max-ibk-regierung-neuordnung
- vorlage-experimentier-01
- max-ibk-post
- max-ibk-hof
- max-ibk-hofleben
- max-ibk-ibk-vor-max
- max-ibk-um-1500
- max-ibk-turniere
- max-ibk-kunst
- Max-ibk-kunst-a
- max-ibk-musik
- max-ibk-letzter-besuch
- max-ibk-tod-wels
- hofki-baugeschichte
- max-ibk-bianca-sforza
- max-ibk-plattnereien
- max-ibk-gusshuetten
- max-ibk-gedechtnus
- max-ibk-hofburg
- max-ibk-wappenturm
- max-ibk-zeughaus-sill
- max-ibk-goldenes-dachl
- max-ibk-hofkirche
- max-ibk-quaternionenadler
- max-ibk-altstadthaeuser
- max-ibk-erinnerungen
- ergaenz-figuren-habsb-einordnung
- hofki-aussen
- grabmal-ideen-vorbilder
- ergaenz-babenberger
- ergaenz-habsburger
- ergaenz-gesch-tirol-bis-16-jh
- ergaenz-habsb-burgund
- ergaenz-habsb-spanien
- ergaenz-heiliges-roemisches-reich
- ergaenz-kaiser-koenig-eh
- ergaenz-erblande-stammlande
- ergaenz-kronen
- ergaenz-wappen
- ergaenz-goldenes-vlies
- ergaenz-priv-minus-maius
- ergaenz-vorderoesterreich
- ergaenz-ehevertraege-heirat
- ergaenz-figuren-mode-frauen
- erganz-figuren-ruestungen-maenner
- erganz-figuren-portraet
- ergaenz-max-portrait
- ergaenz-familienportrait
- ergaenz-tratzberg-stammbaum
- Erganz-figuren-portraet-a
- ergaenz-max-kunst
- ergaenz-theurdank-etc
- figuren-bianca-maria
- grabmal-programm-figuren
- grabmal-aussage
- grabmal-geplantes-aussehen
- grabmal-planung
- grabmal-gusshuetten
- grabmal-heilige
- grabmal-antike-kaiser
- grabmal-hochgrab
- grabmal-marmorreliefs
- grabmal-gitter
- figuren-uebersicht
- figuren-chlodwig
- figuren-friedrich-leere-tasche
- figuren-ferdinand-aragon
- figuren-graf-albrecht-4
- figuren-albrecht-5-koenig-2
- figuren-johanna-wahnsinnige
- figuren-rudolf-habsburg-koenig
- figuren-zimburgis
- figuren-ernst-eiserne
- figuren-leopold-3-herzog
- figuren-markgraf-leopold-3-hlge
- figuren-artus
- figuren-johann-portugal
- figuren-theoderich
- figuren-albrecht-2-weise-lahme
- figuren-gottfried-bouillon
- figuren-albrecht-1-koenig
- figuren-elisabeth-goerz-tirol
- figuren-elisabeth-ungarn
- figuren-kunigunde
- figuren-philipp-gute-burgund
- figuren-karl-kuehne-burgund
- figuren-friedrich-4-leer-tasche
- figuren-sigmund-muenzreiche
- figuren-kaiser-friedrich-3
- figuren-philipp-schoene
- figuren-maria-burgund
- figuren-margarete-oesterreich
- schueler-vorlage-leer-01
- schueler-grundstufe-willkommen
- schueler-grundstufe-maximilian
- schueler-grundstufe-erster-blick-kirche
- schueler-grundstufe-grosse-figuren
- schueler-grundstufe-grabmal-leer
- schueler-grundstufe-zwei-frauen
- schueler-grundstufe-kinder
- schueler-grundstufe-friedrich-4
- schueler-grundstufe-sigmund
- schueler-grundstufe-max-tirol
- schueler-grundstufe-max-innsbruck
- schueler-grundstufe-zusammenfassung
- schueler-mittelstufe-willkommen
- schueler-mittelstufe-maximilian
- schueler-mittelstufe-habsburg
- schueler-mittelstufe-mx-frauen
- schueler-mittelstufe-max-kinder
- schueler-mittelstufe-max-tirol
- schueler-mittelstufe-max-innsbruck
- schueler-mittelstufe-erster-blick-hofkirche
- schueler-mittelstufe-figuren
- Schueler-mittelstufe-figuren-a
- schueler-mittelstufe-grabmal
- schueler-mittelstufe-friedrich-4
- schueler-mittelstufe-sigmund
- schueler-mittelstufe-silberne-kapelle
- schueler-mittelstufe-ferdinand-philippine
- schueler-ueberblick-basistext
- schueler-ueberblick-standardtext
- schueler-ueberblick-expertentext
- lehrer-willkommen
- lehrer-vorlage-leer
- lehrer-kopiervorlagen
- lehrer-vorschlaege-besuch-kirche
- lehrer-be-unterricht
- hofki-leer-vorlage
- hofki-innen-gesamt
- hofki-altarraum
- hofki-altaere
- hofki-grabmaeler-denkmaeler
- hofki-besonderheiten
- hofki-neues-stift-volkskunstmuseum
- hofki-silberne-kapelle
- imnpressum-literatur
- spiele-puzzles
- spiele-verschiedenes