
Maximilian und Innsbruck
Altstadthäuser
Das heutige Stadtbild der
Innsbrucker Altstadt geht
großteils auf die Zeit Kaiser
Maximilians I. zurück.
Das Innsbrucker Altstadthaus
gehört dem Inn-Salzach-Typus an.
Es ist hoch, schmal, geht weit nach
hinten, hat einen niederen Giebel
oder einen flachen Abschluss. Die
ältesten Häuser waren aus Holz-
und Fachwerk. Nach dem letzten
großen Stadtbrand von 1390
wurden Steinbauten errichtet.
Sehr viele Häuser stammen noch aus der Zeit vor 1500, wurden aber in
der Zeit Kaiser Maximilians I. umgebaut oder neu errichtet. Führend war
damals die Steinmetz- und Baumeisterfamilie Türing, vor allem Gregor
Türing.
Als Baumaterial fanden früher
grundsätzlich Steine aus der
Umgebung Verwendung. Oft diente
Höttinger Breccie als
Verkleidungsmaterial. Wegen der
häufigen Erdbeben im Inntal - vor
allem 1670 und 1689 - wurden an
vielen Innsbrucker Häusern
Mauerstützen aus Höttinger Breccie
angebracht. Sie laufen schräg zur
Hauswand und reichen bis zum ersten
oder zweiten Stockwerk. Diese
Höttinger Breccie ist zwischen dem
heutigen Alpenzoo und der
Hungerburg zu finden.
Typisch für das Altstadthaus in
Innsbruck sind das Graben-
und Muldendach. Für
benachbarte Häuser liegt bei
Sattel- oder Giebeldächern die
Traufe (Regenrinne) im
einspringenden Winkel, den
die aneinandergerückten
Dachpulte bilden. Somit können die Trennmauern zwischen zwei Häusern
leicht durchfeuchtet werden. Dem entgeht man, indem man die
Trennmauern hochzieht und das Dach zur Hausmitte hin einspringen
lässt. Bei schmalen Häusern springt das Dach nur einmal ein, man spricht
vom Grabendach. Bei breiteten Häusern kann das Dach zwei- oder
mehrmals einspringen, wodurch das Muldendach entsteht.
Vorkragende Stockwerke, wie es bei vielen mittelalterlichen Häusern in
Deutschland oder England üblich ist, verbot Kaiser Maximilian wegen der
Brandgefahr. Maximilian ordnete auch an, dass die Trennmauern über
das Dach aufstanden, um das Übergreifen des Feuers von einem Haus auf
das andere zu verhindern. Man spricht von der “innsbruckerischen
Bauweise”, die im Habsburgerreich üblich war.
Im Erdgeschoss befanden sich
Lagerräume, Werkstätten oder
Geschäftsräume. Das Stiegenhaus
befand sich ungefähr in der Hausmitte
und wurde durch einen Lichtschacht
erhellt. Die Wohnungen lagen in den
Obergeschossen. Eine Wohnung bestand
meist aus der Stube (Wohnzimmer, nach
vorne zur Straße), der Küche (in den
Lichtschacht) und der Kammer
(Schlafzimmer, nach hinten). Typisch sind
auch die Lauben (früher als “Gwölb”
bezeichnet) und die Erker.
Man muss allerdings auch erwähnen, dass die meisten Häuser
ursprünglich nur aus Erdgeschoss und zwei Stockwerken bestanden und
später aufgestockt wurden.
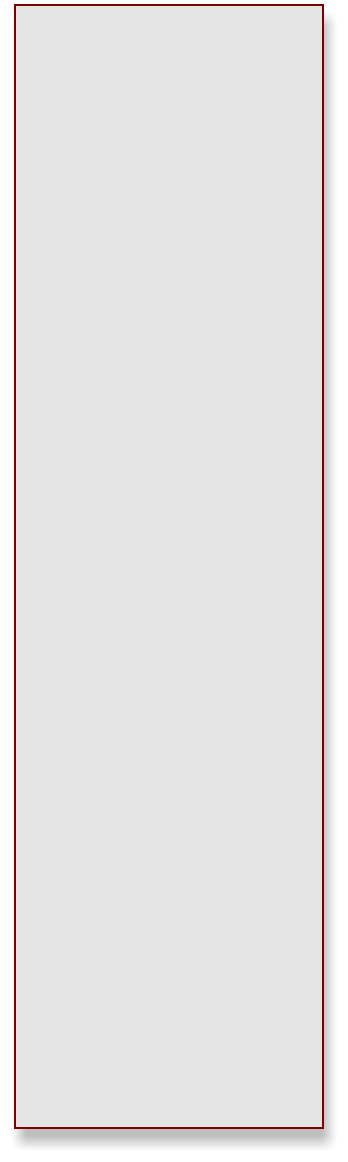
Inn-Salzach-Stadt
Im Bereich der Flüsse Inn und
Salzach hat sich ein bestimmter
Stadttypus entwickelt. Kennzeichen
sind: häufig schmaler,
langgezogener Grundriss, bei den
Stadttoren sehr eng, Hauptstraße
erweitert sich zu einem Marktplatz,
enge Seitengassen, Gewerbe am
Stadtrand, an der Hauptraße die
reichen Bürger- und
Handelshäuser, Pfarrkirche,
Friedhof, Spital und Spitalskirche
häufig am Stadtrand.
Bürgerhaus der Inn-Salzach-Stadt
Die Häuser stehen giebelseitig zur
Straße, sind schmal und hoch (aus
Platzmangel), Graben- und
Muldendächer, Erker, oberer
Abschluss Treppengiebel oder
Blendgiebel (Dachform dahinter
nicht sichtbar), Lauben (Schutz vor
Hitze und Kälte, dort früher oft
Marktstände), im Erdgeschoss
Werkstätten oder Geschäfte, enge
Stiegenaufgänge, Lichtschacht
gegen die Hausmitte, in der Regel
pro Stock drei Räume (Stube bzw.
Wohnzimmer zur Straße, Küche in
den Lichtschacht, Kammer bzw.
Schlafzimmer nach hinten).
Inn-Salzachstädte in Nord- , Ost-
und Sütirol: Kufstein, Kitzbühel,
Rattenberg, Hall in Tirol, Innsbruck,
Lienz, Sterzing, Bruneck, Brixen,
Klausen, Bozen, Meran, Glurns
Andere Inn-Salzach-Städte:
Rosenheim, Burghausen, Passau,
Wasserburg, Altötting, Schärding,
Braunau u. a.












- Jugend und Erziehung
- Zeit in Burgund
- Maria von Burgund
- Wahl zum deutschen König - 1486
- Erwerb Tirols - 1490
- Wiedererlangung der östlichen Erbländer
- Bretonischer Krieg - Anne de Bretagne
- Nachfolge im Reich - Reichsreformen
- Türkeneinfälle - Politik in Italien
- Bianca Maria Sforza
- Heilige Liga von Venedig - Spanische Doppelhochzeit
- Italienfeldzug 1496
- Weitere Rückschläge
- Ausgleich mit Frankreich - Rom-Spanien-Görz
- Bayerisch-pfälzischer Erbfolgekrieg
- Ungarn - Feldzug und Heiratspläne
- Tod Philipps des Schönen - Probleme mit Frankreich
- Kaiserproklamation in Trient - 1508
- Der Kaiser-Papst-Plan
- Italienkriege - Französisches Bündnis
- Ausgang der Italienkriege
- Der Osten - Ungarisches Doppelverlöbnis
- Letzte Lebensjahre
- Tod und Beisetzung


- Regierungsantritt 1490
- Regierung - Neuordnung
- Postlinie
- Hof in Innsbruck
- Hofleben
- Innsbruck vor Maximilian
- Innsbruck um 1500
- Turniere in Innsbruck
- Kunst in Innsbruck
- Musik am Hof
- Maximilians letzter Besuch
- Maximilians Tod in Wels
- Bianca Maria Sforza
- Plattnereien
- Gusshütten
- Ewiges Gedächtnis
- Hofburg
- Wappenturm
- Zeughaus an der Sill
- Goldenes Dachl
- Hofkirche und leeres Grabmal
- Quaternionenadler
- Altstadthäuser
- Erinnerungen im Überblick


- Figuren im Überblick
- Albrecht I. - Herzog, König
- Albrecht II. - Herzog, Weise, Lahme
- Albrecht II. - König
- Albrecht IV. - Graf von Habsburg
- Artus - König England
- Bianca Maria Sforza
- Chlodwig - König
- Elisabeth von Görz-Tirol
- Elisabeth von Ungarn und Böhmen
- Ernst der Eiserne - Herzog
- Ferdinand von Aragon - König
- Friedrich III. - Kaiser
- Friedrich IV. - Herzog - Tirol
- Gottfried von Bouillon
- Johann von Portugal - König
- Johanna die Wahnsinnige - Spanien
- Karl der Kühne - Herzog, Burgund
- Kunigunde - Erzherzogin
- Leopold III. - Markgraf, Babenberger
- Leopold III. - Herzog - Tirol
- Margarethe von Österreich
- Maria von Burgund
- Philipp der Gute - Herzog, Burgund
- Philipp der Schöne - Herzog
- Rudolf von Habsburg - König
- Sigmund d. Münzreiche - Erzherzog
- Theoderich - König, Ostgoten
- Zimburgis von Masowien
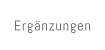
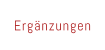
- Figuren Habsburger - Einordnung
- Babenberger und Österreich
- Habsburger und Österreich
- Geschichte Tirols bis 16. Jh.
- Habsburg und Burgund
- Habsburg und Spanien
- Heiliges Römisches Reich
- Kaiser-König-Erzherzog-Herzog
- Erblande-Stammlande-Vorlande
- Kronen
- Wappen
- Orden vom Goldenen Vlies
- Privilegium minus - maius
- Vorlande - Vorderösterreich
- Eheverträge - Heirat - Kinder
- Figuren - Mode der Damen
- Figuren - Rüstungen der Herren
- Figuren - Porträtgenauigkeit
- Maximilian im Porträt (A. Dürer)
- Maximilian - Familienporträt
- Habsburgerstammbaum - Tratzberg
- Maximilian und die Kunst
- Theuerdank - Weißkunig - Freydal

Exercitation est ullamco et
commodo ut. Reprehenderit
enim nisi voluptate, nostrud
irure mollit ullamco nulla
dolore in? Non ad dolore, in
incididunt irure exercitation
ut dolore fugiat ullamco
ipsum et sunt labore duis
nulla pariatur enim. Irure
culpa aliqua, sunt, nisi dolor
consectetur veniam
cupidatat non nostrud
laboris culpa. Nisi esse, sint,
enim esse est sed cupidatat
sit elit.
Ex dolore enim: Incididunt in consequat duis do ut
officia sunt ut elit. Adipisicing cupidatat id ipsum
quis ea ut ullamco ad officia aute aliquip occaecat
non duis.
Exercitation consectetur sunt pariatur
Sit deserunt proident ad in fugiat adipisicing esse labore aute, exercitation id sint ut. Sit cillum est, voluptate magna, cillum dolore anim et in in sunt, voluptate dolor labore. Deserunt, amet ipsum excepteur minim. Sed eiusmod irure amet in occaecat esse cillum ad excepteur ut et, sunt irure ut, dolor eiusmod nostrud officia. Excepteur, fugiat laboris, proident enim in. Mollit ullamco amet anim labore voluptate qui deserunt sint ad ut: Sit enim ad commodo eu magna esse voluptate veniam consectetur ullamco lorem, in sunt reprehenderit velit ipsum. Aliquip qui lorem qui sit.Elit dolor dolore nulla. Excepteur dolore consequat non sed et magna sint aliqua consequat, qui sed nostrud, duis eu. Quis duis tempor esse ut pariatur ipsum.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor
eu eiusmod lorem 2013

SIMPLICITY


Dolor sunt occaecat commodo officia deserunt
irure. Dolore eu in enim aliqua qui labore
consequat laboris qui officia ipsum. In ea minim
culpa duis consequat cupidatat do.
Cupidatat lorem quis tempor reprehenderit quis
aliqua pariatur aliquip eiusmod ut minim dolore in
nostrud mollit enim velit in. Ullamco non
exercitation. Velit ullamco sint occaecat veniam
dolore aliqua ipsum in reprehenderit sed do aliqua
nulla enim ut.
Sed dolore tempor eiusmod esse laboris dolore,
esse deserunt aliquip sit aute, labore sunt anim. Ad
anim ipsum eiusmod in elit incididunt non sint
tempor sunt ad incididunt aliquip do! Ut amet
pariatur sint, elit labore pariatur ut aute.


- HOME
- max-jugend-erziehunjg
- max-burgund
- vorlage-01
- max-maria-burgund
- max-wahl-dt-koenig
- max-erwerb-tirol
- max-wiedere-oestl-erblaender
- max-bretonischer-krieg-ann-bretagne
- max-nachfolge-reich
- max-tuerken-italien
- max-hochzeit-bianca-maria-sforza
- max-liga-venedig-span-doppelhochzeit
- max-italienfeld-1496
- max-weitere-rueckschlaege
- max-ausgleich-frankreich-rom-spanien-goerz
- max-bayerische-erbfolgekrieg
- max-ungarn-heiratsplaene
- max-tod-philipps
- max-trient
- max-kaiser-papst
- max-italienkriege-franz-buendnis
- max-ausgang-italienkriege
- max-osten-doppelverloebnis
- max-letzte-jahre
- max-tod-beisetzung
- max-tirol-bedeutung
- max-jagd
- max-jagd-arten
- max-jagd-waffen-hunde
- max-tirol-vergroesserung
- max-tirol-landlibell
- max-tirol-bodenschaetze
- max-tirol-grafschaft
- max-tirol-orte
- max-ibk-regierungsantritt
- max-ibk-regierung-neuordnung
- vorlage-experimentier-01
- max-ibk-post
- max-ibk-hof
- max-ibk-hofleben
- max-ibk-ibk-vor-max
- max-ibk-um-1500
- max-ibk-turniere
- max-ibk-kunst
- Max-ibk-kunst-a
- max-ibk-musik
- max-ibk-letzter-besuch
- max-ibk-tod-wels
- hofki-baugeschichte
- max-ibk-bianca-sforza
- max-ibk-plattnereien
- max-ibk-gusshuetten
- max-ibk-gedechtnus
- max-ibk-hofburg
- max-ibk-wappenturm
- max-ibk-zeughaus-sill
- max-ibk-goldenes-dachl
- max-ibk-hofkirche
- max-ibk-quaternionenadler
- max-ibk-altstadthaeuser
- max-ibk-erinnerungen
- ergaenz-figuren-habsb-einordnung
- hofki-aussen
- grabmal-ideen-vorbilder
- ergaenz-babenberger
- ergaenz-habsburger
- ergaenz-gesch-tirol-bis-16-jh
- ergaenz-habsb-burgund
- ergaenz-habsb-spanien
- ergaenz-heiliges-roemisches-reich
- ergaenz-kaiser-koenig-eh
- ergaenz-erblande-stammlande
- ergaenz-kronen
- ergaenz-wappen
- ergaenz-goldenes-vlies
- ergaenz-priv-minus-maius
- ergaenz-vorderoesterreich
- ergaenz-ehevertraege-heirat
- ergaenz-figuren-mode-frauen
- erganz-figuren-ruestungen-maenner
- erganz-figuren-portraet
- ergaenz-max-portrait
- ergaenz-familienportrait
- ergaenz-tratzberg-stammbaum
- Erganz-figuren-portraet-a
- ergaenz-max-kunst
- ergaenz-theurdank-etc
- figuren-bianca-maria
- grabmal-programm-figuren
- grabmal-aussage
- grabmal-geplantes-aussehen
- grabmal-planung
- grabmal-gusshuetten
- grabmal-heilige
- grabmal-antike-kaiser
- grabmal-hochgrab
- grabmal-marmorreliefs
- grabmal-gitter
- figuren-uebersicht
- figuren-chlodwig
- figuren-friedrich-leere-tasche
- figuren-ferdinand-aragon
- figuren-graf-albrecht-4
- figuren-albrecht-5-koenig-2
- figuren-johanna-wahnsinnige
- figuren-rudolf-habsburg-koenig
- figuren-zimburgis
- figuren-ernst-eiserne
- figuren-leopold-3-herzog
- figuren-markgraf-leopold-3-hlge
- figuren-artus
- figuren-johann-portugal
- figuren-theoderich
- figuren-albrecht-2-weise-lahme
- figuren-gottfried-bouillon
- figuren-albrecht-1-koenig
- figuren-elisabeth-goerz-tirol
- figuren-elisabeth-ungarn
- figuren-kunigunde
- figuren-philipp-gute-burgund
- figuren-karl-kuehne-burgund
- figuren-friedrich-4-leer-tasche
- figuren-sigmund-muenzreiche
- figuren-kaiser-friedrich-3
- figuren-philipp-schoene
- figuren-maria-burgund
- figuren-margarete-oesterreich
- schueler-vorlage-leer-01
- schueler-grundstufe-willkommen
- schueler-grundstufe-maximilian
- schueler-grundstufe-erster-blick-kirche
- schueler-grundstufe-grosse-figuren
- schueler-grundstufe-grabmal-leer
- schueler-grundstufe-zwei-frauen
- schueler-grundstufe-kinder
- schueler-grundstufe-friedrich-4
- schueler-grundstufe-sigmund
- schueler-grundstufe-max-tirol
- schueler-grundstufe-max-innsbruck
- schueler-grundstufe-zusammenfassung
- schueler-mittelstufe-willkommen
- schueler-mittelstufe-maximilian
- schueler-mittelstufe-habsburg
- schueler-mittelstufe-mx-frauen
- schueler-mittelstufe-max-kinder
- schueler-mittelstufe-max-tirol
- schueler-mittelstufe-max-innsbruck
- schueler-mittelstufe-erster-blick-hofkirche
- schueler-mittelstufe-figuren
- Schueler-mittelstufe-figuren-a
- schueler-mittelstufe-grabmal
- schueler-mittelstufe-friedrich-4
- schueler-mittelstufe-sigmund
- schueler-mittelstufe-silberne-kapelle
- schueler-mittelstufe-ferdinand-philippine
- schueler-ueberblick-basistext
- schueler-ueberblick-standardtext
- schueler-ueberblick-expertentext
- lehrer-willkommen
- lehrer-vorlage-leer
- lehrer-kopiervorlagen
- lehrer-vorschlaege-besuch-kirche
- lehrer-be-unterricht
- hofki-leer-vorlage
- hofki-innen-gesamt
- hofki-altarraum
- hofki-altaere
- hofki-grabmaeler-denkmaeler
- hofki-besonderheiten
- hofki-neues-stift-volkskunstmuseum
- hofki-silberne-kapelle
- imnpressum-literatur
- spiele-puzzles
- spiele-verschiedenes














