
Maximilian und Innsbruck
Innsbruck um 1500
Um 1500 hatte Innsbruck rund 5.000 Einwohner, mit den umliegenden
Dörfern und Vororten rund 7.000.
Damals bestand die Stadt aus folgenden Teilen:
•
Altstadt
•
Neustadt (heutige Maria-Theresien-Straße bis zum heutigen Alten
Landhaus)
•
Silbergasse in Richtung
Osten zum Zeughaus an
der Sill (teilweise die
heutige Universitätsstraße
und Dreiheiligen)
•
Innrain entlang des Inns in
Richtung Westen
•
Ursprüngliches Innsbruck
ab 1133 auf der linken
Innseite (heutige Stadtteile
St. Nikolaus und Mariahilf)
Als Zentrum von Handel, Verkehr, Verwaltung und Regierung nahm die
Stadt eine Sonderstellung ein. Maximilian besuchte Innsbruck sehr gerne,
wenn auch nur selten, meist nur tage- oder wochenweise, kaum länger. Er
tat sehr viel zur Ausgestaltung der Stadt. Innsbruck wurde zu seinem
Verwaltungszentrum, zum Sitz der Verwaltungsbehörden, denen auch die
Wiener Behörden unterstellt waren.
Maximilian stiftete auch das
sogenannte Kaiserspital, eine
Art Heim für zwölf alte Männer.
Sehr schlecht bestellt war es
um die hygienischen Belange
der Stadt. Maximilian verbot,
alle Abwässer, auch jene aus
Aborten, einfach auf die Straße
oder in die Straßengräben zu
schütten. Sie mussten in den Inn oder in die Bäche geleitet werden. Auch
die Lagerung von Küchenabfällen und Mist in den Gassen und Häusern
war nicht mehr erlaubt. Zahlreiche Stadtbewohner hielten nämlich Vieh
in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss.
Die Fleischbank (Metzgerei) wurde auf die Innbrücke verlegt, wo nicht
verwertbare Tierreste in den Fluss geworfen werden konnten. Diese
Fleischbank bestand aus einem kleinen Haus, das an die Brücke angebaut
war.
Auf Anordnung Maximilians
wurde das Goldene Dachl von
Niklas Türing am Neuhof
angebaut. Dieser Prunkerker
sollte zur Verschönerung der
Stadt und als Aufenthaltsort des
Fürsten bei Schauspielen und
Turnieren dienen.
Maximilian ließ auch den Friedhof um die St.-Jakobs-Pfarrkirche
entfernen und außerhalb der Stadt bei der Spitalskirche in der Neustadt
(Maria-Theresien-Straße) anlegen, wo er westlich der Kirche im Bereich
des heutigen Adolf-Pichler-Platzes bis zum Ende des 19. Jh. bestand.
Danach entstand der Westfriedhof weit außerhalb der Altstadt.
Die Stadt erhielt von Maximilian Privilegien (Vorrechte), die für die
Bürger Wohlstand bedeuteten. So etwa stellte die Einnahme von
Straßenzöllen eine wichtige Geldquelle dar. Wichtig war auch das
Marktrecht. Die Stadtbewohner - Händler, Kaufleute, Beamte,
Handwerker u. a. - konnten sich bei den Wochenmärkten, zu denen die
Bauern aus dem umliegenden Dörfern in die Stadt kamen, mit
Lebensmitteln eindecken.
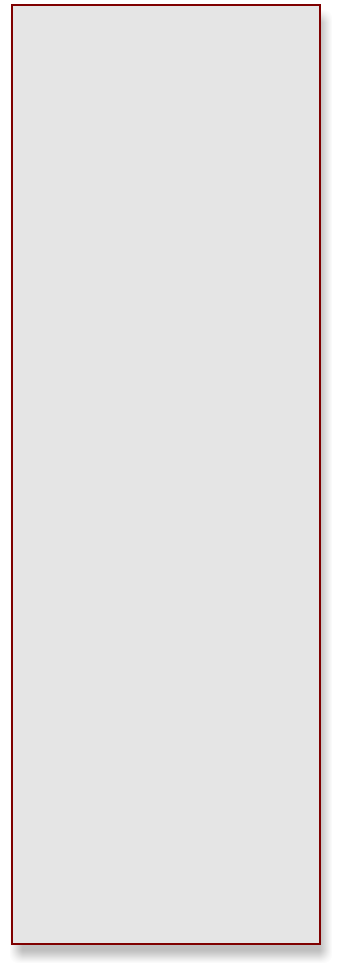
“Innspruggerische Bauweise”
Ein großes Problem stellten damals
die häufigen Brände dar. Nach dem
letzten großen Stadtbrand von
1390 wurden die meisten
Holzhäuser durch Steinbauten
ersetzt. Maximilian ließ die Dächer
mit Ziegeln decken und
Mantelmauern um die Häuser
aufziehen, damit bei einem
Dachbrand das Feuer nicht so
leicht überspringen konnte. Dazu
dienten auch die Graben- und
Muldendächer. Damals wurde der
Begriff “innspruggerische
Bauweise” geprägt, die auch in
anderen Städten im
Habsburgerreich Verwendung
fand.
In der Zeit Maximilians wurde
mehr als die Hälfte der
Altstadthäuser renoviert bzw. neu
erbaut. Niklas und Gregor Türing
werden als Stadtbaumeister
bezeichnet, Maximilian als
Stadtbauherr. Das heutige
Erscheinungsbild der Altstadt geht
großteils auf ihn zurück. Allerdings
waren die meisten Häuser damals
niedriger und wurden erst später
aufgestockt. Die Neustadt und die
Silbergasse wurden gepflastert.










- Jugend und Erziehung
- Zeit in Burgund
- Maria von Burgund
- Wahl zum deutschen König - 1486
- Erwerb Tirols - 1490
- Wiedererlangung der östlichen Erbländer
- Bretonischer Krieg - Anne de Bretagne
- Nachfolge im Reich - Reichsreformen
- Türkeneinfälle - Politik in Italien
- Bianca Maria Sforza
- Heilige Liga von Venedig - Spanische Doppelhochzeit
- Italienfeldzug 1496
- Weitere Rückschläge
- Ausgleich mit Frankreich - Rom-Spanien-Görz
- Bayerisch-pfälzischer Erbfolgekrieg
- Ungarn - Feldzug und Heiratspläne
- Tod Philipps des Schönen - Probleme mit Frankreich
- Kaiserproklamation in Trient - 1508
- Der Kaiser-Papst-Plan
- Italienkriege - Französisches Bündnis
- Ausgang der Italienkriege
- Der Osten - Ungarisches Doppelverlöbnis
- Letzte Lebensjahre
- Tod und Beisetzung


- Regierungsantritt 1490
- Regierung - Neuordnung
- Postlinie
- Hof in Innsbruck
- Hofleben
- Innsbruck vor Maximilian
- Innsbruck um 1500
- Turniere in Innsbruck
- Kunst in Innsbruck
- Musik am Hof
- Maximilians letzter Besuch
- Maximilians Tod in Wels
- Bianca Maria Sforza
- Plattnereien
- Gusshütten
- Ewiges Gedächtnis
- Hofburg
- Wappenturm
- Zeughaus an der Sill
- Goldenes Dachl
- Hofkirche und leeres Grabmal
- Quaternionenadler
- Altstadthäuser
- Erinnerungen im Überblick


- Figuren im Überblick
- Albrecht I. - Herzog, König
- Albrecht II. - Herzog, Weise, Lahme
- Albrecht II. - König
- Albrecht IV. - Graf von Habsburg
- Artus - König England
- Bianca Maria Sforza
- Chlodwig - König
- Elisabeth von Görz-Tirol
- Elisabeth von Ungarn und Böhmen
- Ernst der Eiserne - Herzog
- Ferdinand von Aragon - König
- Friedrich III. - Kaiser
- Friedrich IV. - Herzog - Tirol
- Gottfried von Bouillon
- Johann von Portugal - König
- Johanna die Wahnsinnige - Spanien
- Karl der Kühne - Herzog, Burgund
- Kunigunde - Erzherzogin
- Leopold III. - Markgraf, Babenberger
- Leopold III. - Herzog - Tirol
- Margarethe von Österreich
- Maria von Burgund
- Philipp der Gute - Herzog, Burgund
- Philipp der Schöne - Herzog
- Rudolf von Habsburg - König
- Sigmund d. Münzreiche - Erzherzog
- Theoderich - König, Ostgoten
- Zimburgis von Masowien
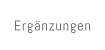
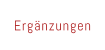
- Figuren Habsburger - Einordnung
- Babenberger und Österreich
- Habsburger und Österreich
- Geschichte Tirols bis 16. Jh.
- Habsburg und Burgund
- Habsburg und Spanien
- Heiliges Römisches Reich
- Kaiser-König-Erzherzog-Herzog
- Erblande-Stammlande-Vorlande
- Kronen
- Wappen
- Orden vom Goldenen Vlies
- Privilegium minus - maius
- Vorlande - Vorderösterreich
- Eheverträge - Heirat - Kinder
- Figuren - Mode der Damen
- Figuren - Rüstungen der Herren
- Figuren - Porträtgenauigkeit
- Maximilian im Porträt (A. Dürer)
- Maximilian - Familienporträt
- Habsburgerstammbaum - Tratzberg
- Maximilian und die Kunst
- Theuerdank - Weißkunig - Freydal

Exercitation est ullamco et
commodo ut. Reprehenderit
enim nisi voluptate, nostrud
irure mollit ullamco nulla
dolore in? Non ad dolore, in
incididunt irure exercitation
ut dolore fugiat ullamco
ipsum et sunt labore duis
nulla pariatur enim. Irure
culpa aliqua, sunt, nisi dolor
consectetur veniam
cupidatat non nostrud
laboris culpa. Nisi esse, sint,
enim esse est sed cupidatat
sit elit.
Ex dolore enim: Incididunt in consequat duis do ut
officia sunt ut elit. Adipisicing cupidatat id ipsum
quis ea ut ullamco ad officia aute aliquip occaecat
non duis.
Exercitation consectetur sunt pariatur
Sit deserunt proident ad in fugiat adipisicing esse labore aute, exercitation id sint ut. Sit cillum est, voluptate magna, cillum dolore anim et in in sunt, voluptate dolor labore. Deserunt, amet ipsum excepteur minim. Sed eiusmod irure amet in occaecat esse cillum ad excepteur ut et, sunt irure ut, dolor eiusmod nostrud officia. Excepteur, fugiat laboris, proident enim in. Mollit ullamco amet anim labore voluptate qui deserunt sint ad ut: Sit enim ad commodo eu magna esse voluptate veniam consectetur ullamco lorem, in sunt reprehenderit velit ipsum. Aliquip qui lorem qui sit.Elit dolor dolore nulla. Excepteur dolore consequat non sed et magna sint aliqua consequat, qui sed nostrud, duis eu. Quis duis tempor esse ut pariatur ipsum.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor
eu eiusmod lorem 2013

SIMPLICITY


Dolor sunt occaecat commodo officia deserunt
irure. Dolore eu in enim aliqua qui labore
consequat laboris qui officia ipsum. In ea minim
culpa duis consequat cupidatat do.
Cupidatat lorem quis tempor reprehenderit quis
aliqua pariatur aliquip eiusmod ut minim dolore in
nostrud mollit enim velit in. Ullamco non
exercitation. Velit ullamco sint occaecat veniam
dolore aliqua ipsum in reprehenderit sed do aliqua
nulla enim ut.
Sed dolore tempor eiusmod esse laboris dolore,
esse deserunt aliquip sit aute, labore sunt anim. Ad
anim ipsum eiusmod in elit incididunt non sint
tempor sunt ad incididunt aliquip do! Ut amet
pariatur sint, elit labore pariatur ut aute.


- HOME
- max-jugend-erziehunjg
- max-burgund
- vorlage-01
- max-maria-burgund
- max-wahl-dt-koenig
- max-erwerb-tirol
- max-wiedere-oestl-erblaender
- max-bretonischer-krieg-ann-bretagne
- max-nachfolge-reich
- max-tuerken-italien
- max-hochzeit-bianca-maria-sforza
- max-liga-venedig-span-doppelhochzeit
- max-italienfeld-1496
- max-weitere-rueckschlaege
- max-ausgleich-frankreich-rom-spanien-goerz
- max-bayerische-erbfolgekrieg
- max-ungarn-heiratsplaene
- max-tod-philipps
- max-trient
- max-kaiser-papst
- max-italienkriege-franz-buendnis
- max-ausgang-italienkriege
- max-osten-doppelverloebnis
- max-letzte-jahre
- max-tod-beisetzung
- max-tirol-bedeutung
- max-jagd
- max-jagd-arten
- max-jagd-waffen-hunde
- max-tirol-vergroesserung
- max-tirol-landlibell
- max-tirol-bodenschaetze
- max-tirol-grafschaft
- max-tirol-orte
- max-ibk-regierungsantritt
- max-ibk-regierung-neuordnung
- vorlage-experimentier-01
- max-ibk-post
- max-ibk-hof
- max-ibk-hofleben
- max-ibk-ibk-vor-max
- max-ibk-um-1500
- max-ibk-turniere
- max-ibk-kunst
- Max-ibk-kunst-a
- max-ibk-musik
- max-ibk-letzter-besuch
- max-ibk-tod-wels
- hofki-baugeschichte
- max-ibk-bianca-sforza
- max-ibk-plattnereien
- max-ibk-gusshuetten
- max-ibk-gedechtnus
- max-ibk-hofburg
- max-ibk-wappenturm
- max-ibk-zeughaus-sill
- max-ibk-goldenes-dachl
- max-ibk-hofkirche
- max-ibk-quaternionenadler
- max-ibk-altstadthaeuser
- max-ibk-erinnerungen
- ergaenz-figuren-habsb-einordnung
- hofki-aussen
- grabmal-ideen-vorbilder
- ergaenz-babenberger
- ergaenz-habsburger
- ergaenz-gesch-tirol-bis-16-jh
- ergaenz-habsb-burgund
- ergaenz-habsb-spanien
- ergaenz-heiliges-roemisches-reich
- ergaenz-kaiser-koenig-eh
- ergaenz-erblande-stammlande
- ergaenz-kronen
- ergaenz-wappen
- ergaenz-goldenes-vlies
- ergaenz-priv-minus-maius
- ergaenz-vorderoesterreich
- ergaenz-ehevertraege-heirat
- ergaenz-figuren-mode-frauen
- erganz-figuren-ruestungen-maenner
- erganz-figuren-portraet
- ergaenz-max-portrait
- ergaenz-familienportrait
- ergaenz-tratzberg-stammbaum
- Erganz-figuren-portraet-a
- ergaenz-max-kunst
- ergaenz-theurdank-etc
- figuren-bianca-maria
- grabmal-programm-figuren
- grabmal-aussage
- grabmal-geplantes-aussehen
- grabmal-planung
- grabmal-gusshuetten
- grabmal-heilige
- grabmal-antike-kaiser
- grabmal-hochgrab
- grabmal-marmorreliefs
- grabmal-gitter
- figuren-uebersicht
- figuren-chlodwig
- figuren-friedrich-leere-tasche
- figuren-ferdinand-aragon
- figuren-graf-albrecht-4
- figuren-albrecht-5-koenig-2
- figuren-johanna-wahnsinnige
- figuren-rudolf-habsburg-koenig
- figuren-zimburgis
- figuren-ernst-eiserne
- figuren-leopold-3-herzog
- figuren-markgraf-leopold-3-hlge
- figuren-artus
- figuren-johann-portugal
- figuren-theoderich
- figuren-albrecht-2-weise-lahme
- figuren-gottfried-bouillon
- figuren-albrecht-1-koenig
- figuren-elisabeth-goerz-tirol
- figuren-elisabeth-ungarn
- figuren-kunigunde
- figuren-philipp-gute-burgund
- figuren-karl-kuehne-burgund
- figuren-friedrich-4-leer-tasche
- figuren-sigmund-muenzreiche
- figuren-kaiser-friedrich-3
- figuren-philipp-schoene
- figuren-maria-burgund
- figuren-margarete-oesterreich
- schueler-vorlage-leer-01
- schueler-grundstufe-willkommen
- schueler-grundstufe-maximilian
- schueler-grundstufe-erster-blick-kirche
- schueler-grundstufe-grosse-figuren
- schueler-grundstufe-grabmal-leer
- schueler-grundstufe-zwei-frauen
- schueler-grundstufe-kinder
- schueler-grundstufe-friedrich-4
- schueler-grundstufe-sigmund
- schueler-grundstufe-max-tirol
- schueler-grundstufe-max-innsbruck
- schueler-grundstufe-zusammenfassung
- schueler-mittelstufe-willkommen
- schueler-mittelstufe-maximilian
- schueler-mittelstufe-habsburg
- schueler-mittelstufe-mx-frauen
- schueler-mittelstufe-max-kinder
- schueler-mittelstufe-max-tirol
- schueler-mittelstufe-max-innsbruck
- schueler-mittelstufe-erster-blick-hofkirche
- schueler-mittelstufe-figuren
- Schueler-mittelstufe-figuren-a
- schueler-mittelstufe-grabmal
- schueler-mittelstufe-friedrich-4
- schueler-mittelstufe-sigmund
- schueler-mittelstufe-silberne-kapelle
- schueler-mittelstufe-ferdinand-philippine
- schueler-ueberblick-basistext
- schueler-ueberblick-standardtext
- schueler-ueberblick-expertentext
- lehrer-willkommen
- lehrer-vorlage-leer
- lehrer-kopiervorlagen
- lehrer-vorschlaege-besuch-kirche
- lehrer-be-unterricht
- hofki-leer-vorlage
- hofki-innen-gesamt
- hofki-altarraum
- hofki-altaere
- hofki-grabmaeler-denkmaeler
- hofki-besonderheiten
- hofki-neues-stift-volkskunstmuseum
- hofki-silberne-kapelle
- imnpressum-literatur
- spiele-puzzles
- spiele-verschiedenes














